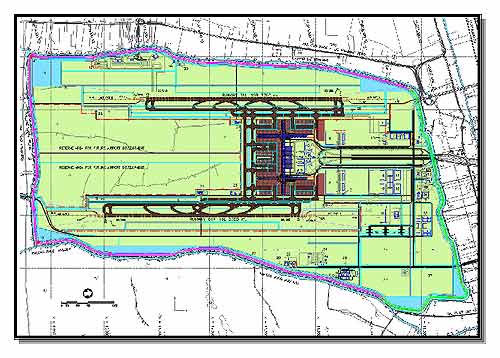Unweit der thailändischen Provinzhauptstadt Lop Buri, rund zwei Autostunden nördlich von Bangkok und abseits der Touristenrouten, führt ein heftig aufstaubender Fahrweg zwischen abgeernteten Maisfeldern hindurch bis zum Fuß des Khaosamjod-Gebirges und endet dort in einer unscheinbaren Klosteranlage.
Von der Landstraße aus ist die Ansammlung schmuckloser Häuser und Hüttchen ebensowenig zu sehen wie der Tempel, der das Areal vom angrenzenden Hang aus überragt. Kein Hinweisschild markiert den Beginn der Piste zu dem Kloster, und selbst wer dessen Namen kennt und sich nach dem Wat Prabat Nampu erkundigt, wartet oft vergebens auf Auskunft.
Und doch genügt, um die kleine Siedlung zu finden, ein einziges Wort, klar und deutlich ausgesprochen: Aids.
Dann weiß jede Marktfrau, jeder Garkoch in der Gegend, welcher Ort gemeint ist, und zeigt kommentarlos oder mit zweideutigen Gesten zwischen Scheu und Abscheu in die gefragte Richtung.
„Da wohnt der Tod“, raunen die Leute in den umliegenden Dörfern und wenden sich voll Argwohn ab. Das Kloster am Ende des Weges ist ebenso berühmt wie berüchtigt, seit Aids-Kranke aus dem ganzen Land dort ihre letzten Tage verbringen.
Doch nicht das Verenden hinfälliger Menschenkörper macht das Wesen dieses Ortes aus, sondern das Sterben als Schlußakt des Daseins, jener bewußt erfahrene Lebensabschnitt vor dem Abtreten, wenn die Pläne allmählich kleiner werden, die Hoffnungen aber nicht.
In dem buddhistischen Hospiz finden Menschen ihre letzte Ruhe, deren Schicksal sich irgendwann im Gestrüpp aus Sextourismus, Prostitution und Drogensucht verfangen hat oder die durch Liebe, Ehe oder Gewalt unglücklich da hineingeraten sind. Hier laufen Lebensgeschichten zusammen, die jede auf ihre Weise den Beginn einer Katastrophe beschreiben: Thailand, das gastfreundliche „freie Land“ mit großer Zukunft, hat sich mit HIV angesteckt und ist dabei, an Aids zu erkranken.
Auf dem Klostergelände, das nicht größer ist als zwei Fußballfelder, wohnen um die 80 Personen, überwiegend Männer, unter ihnen etwa 10 Mönche. Die Zahlen schwanken, wegen der täglichen Zu- und Abgänge. Bei allen lassen sich Antikörper gegen das als Aids-Virus bekannte HIV nachweisen – ausgenommen der Abt, sein Stellvertreter und ein weiterer Mönch.
Ende letzten Jahres gab es zum erstenmal Zuwachs durch Nachwuchs, als die 25jährige Tam Lond ein Baby zur Welt und ein klein wenig Zukunft an diesen Ort der Vergänglichkeit gebracht hat. Während die Mutter noch keine Symptome jenes vielfältigen Leidens aufweist, das mit „Immunschwäche“ nur unzureichend beschrieben ist, weiß Vater Bra Sit, 24, daß sein Sterben bereits begonnen hat. Er fürchtet sich nicht vor dem Tod, sagt er, und doch treibt ihn die Angst um, in Ungewißheit über die Zukunft seiner Tochter sterben zu müssen.
Da seine Frau schon vor Jahren alle Kontakte zu ihrer Familie abgebrochen hat, ruhen Bra Sits Hoffnungen allein auf seinen Eltern. Würden sie das Mädchen zu sich nehmen, wenn er schon nicht mehr wäre? In einem Brief hat er sie gebeten, ihn zu besuchen. Seit sie zugesagt haben, strahlt sein Antlitz fast wieder so, als hätte sich das Leiden nie in seinem Organismus eingenistet.
Wer wie Bra Sit noch selbst essen kann und gehen, die Toilette benutzen und sich waschen, lebt in einer der schlichten Hütten, die den Rand des Areals säumen. Die meisten Bewohner teilen sich zu zweit einen Raum von knapp zehn Quadratmetern. Sie stehen noch oben auf der nach unten ausgerichteten Hierarchie des Sterbens.
Pflegefälle kommen in die kleine Krankenabteilung des Klosters, deren 20 Betten durchweg belegt sind. Für fast alle hier ist die Station eine Art Einbahnstraße durch den letzten Rest Leben. Liegen die weniger Pflegebedürftigen noch in den Betten vorn am Eingang, dann rücken sie mit abnehmender Lebenskraft immer weiter Richtung Hinterausgang, wo täglich neue Särge angeliefert werden. Erreichen sie das Ende der Bettenreihe, rücken sie ins Blickfeld der Krankenschwestern und freiwilligen Helfer. Dort sterben sie schließlich, im Durchschnitt ein bis zwei Menschen pro Tag.
Anders als im Hospital, wo Medizin Leben, aber auch Leiden verlängert, soll im Hospiz Leid verringert und Sterben erleichtert werden. Ein paar Schmerzmittel, Hautsalben, Allerweltsantibiotika, Infusionen gegen Verhungern und vor allem Verdursten, Sauerstoff gegen das grausame Ersticken.
Jeden Morgen zieht Duft von Eukalyptus durch den Saal: wenn sich Patienten selbst oder gegenseitig zur besseren Durchblutung die Glieder mit einer dampfenden Kräutermixtur nach traditionellen Rezepten einreiben.
Im letzten Bett der Station liegt Rattana. Sie ist 45 Jahre alt geworden und wäre gern im Kreise ihrer Familie gestorben. Doch ihr Mann hat das nicht gewollt. Vor ein paar Wochen, als es bergab ging mit ihr, hat er sie hierher gebracht. Er sah seine Stellung als Regierungsbeamter gefährdet, falls die Nachbarn von der Krankheit seiner Frau erführen. Jeder hätte ja gewußt, daß sie sich ihr Aids nur bei ihm geholt haben konnte.
Er selbst hat es wahrscheinlich aus einem Bordell. Solange ihn aber keine Symptome verraten, will er das Bild vom treuen, fleißigen und gesunden Familienvater aufrechterhalten. Den Kindern hat er erzählt, die Mutter sei krank und müsse ihr Leiden in einer speziellen Klinik auskurieren.
Das gespaltene Verhältnis vieler Thai zur Prostitution – sie ist offiziell verboten, gleichwohl so verbreitet wie in kaum einem anderen Land – setzt sich nahtlos fort im Verleugnen der Aids-Problematik: Als seien all jene zu strafen, die durch ihr Leiden und Sterben die Doppelmoral öffentlich machen, gelten Aids-Kranke vielerorts als Unberührbare. So stranden im Wat Prabat Nampu zum Großteil Heimatlose, die hier eine Zuflucht suchen, keine Zukunft.
Mit nichts als einem Koffer kommen sie an, einer kleinen Tasche, manche sogar mit leeren Händen – man braucht so wenig zum Sterben. Nur ein paar werden von Freunden oder Verwandten gebracht, die meisten kommen allein. Sie kommen per Taxi oder Rikscha, einige zu Fuß, manche sind so schwach, daß sie gestützt werden müssen oder getragen.
„Eine Endstation“ sei das, erklärt Bra Sit. So, wie er das sagt, hat er mehr als nur einen Ort im Sinn. Er beschreibt auch einen Gemütszustand, der Reisende mitunter beim Erreichen ihres Zielbahnhofs befällt: Diese Station kann ich nicht verpassen, der Zug endet hier. Es gibt nur Ankommende, eine Art Schicksalsgemeinschaft, und ich kann mir Zeit lassen beim Verlassen des Abteils.
Als Rattana noch klar war und wach, hat manchmal eine junge Mitpatientin bei ihr gesessen, ein heruntergemagertes Mädchen mit hübschem Lächeln, das Besuchern seinen Namen nicht nennt und das sein Gesicht in Kissen vergräbt, sobald ein Fremder es anspricht: eine der Prostituierten im Hospiz.
So sehr schämen sie sich ihrer Schande, daß sie sogar hier die Öffentlichkeit scheuen. Stundenlang hat die Frau Rattana ihr Leben gebeichtet, und Rattana hat ihre eigene Geschichte dagegengehalten – oder einfach nur zugehört.
Man braucht so wenig zum Sterben – und doch so viel für das letzte Stück Leben: Beistand und vielleicht eine Ahnung vom Sinn.
Das Hospiz bietet so etwas wie eine Selbsthilfegruppe mit Generationenvertrag: Ich helfe anderen, denen es schlechter geht, weil bald ich es bin, dem es schlechter geht, und mir dann andere helfen. Und das in einer Dorfgemeinschaft mit Freund- und Nachbarschaften, einem kleinen Laden, einem Tempel und den dorfüblichen Hunden und Katzen mit ihrem dauernden Gezänk und Gezeuge.
Es gibt gemeinsame Mahlzeiten und Meditationen, religiöse Rituale wie das allmorgendliche Beschenken der Mönche mit Almosen, ein wenig Spiel und Bewegung, Yogaübungen und die Lehre Buddhas mit dem Prinzip Wiedergeburt auf dem Weg zum Nibbana, das in Sanskrit Nirwana heißt.
„Vor deinem letzten Atemzug wirst du einen Traum haben“, hat Bruder Som Tschai der sterbenden Rattana erklärt, „darin wird dir erzählt, wohin du nach deinem Tod gelangen wirst.“ Nie sei es zu spät, sich vom Übel zu befreien.
„Was immer dir im Leben zugefügt worden ist, noch dein letzter Gedanke kann es aufwiegen.“
So wollen die Mönche den Kranken eine Haltung näherbringen, die sogar dem Lebensende etwas Versöhnliches geben kann und die wohl keine Sprache so fest im Miteinander der Menschen verankert hat wie das Thai. Widerfährt ihnen Unglück, sagen die Thai leichthin: „Mai pen rai“ – was mit „macht nichts“ oder „halb so schlimm“ nur leidlich übersetzt ist, drückt es doch viel mehr aus als Großmut und Nachsicht. „Mai pen rai“ ist eine Art Kurzformel, um einen Teil thailändischer Mentalität zu verstehen: Ich vergebe, auch ohne darum gebeten zu werden.
Durch solch bedingungsloses Verzeihen sollen Aids-Kranke, die an ihrer Lebensbilanz verzweifeln, einen Weg aus dem Irren zwischen Schuld und Sühne finden.
Rattana hat ihrem Mann vergeben. Sie würde es ihm gern noch sagen, damit er es auch ganz sicher weiß und sie ohne die Last des Vorwurfs gegen ihn ihre Augen endgültig schließen kann. Es muß die Kraft dieses Wunsches sein, die ihr Lebensflämmchen weiterhin nährt.
Schon seit Tagen nimmt sie keine Nahrung mehr zu sich. Nun trinkt sie auch nicht mehr, was das ohnehin schon Greisenhafte ihrer Erscheinung bis ins Groteske verstärkt. Die Lebensäußerungen beschränken sich auf gelegentliches Öffnen der Augen, einen Rest kraftlosen Atmens und auf ein kaum wahrnehmbares Wimmern, wenn die Windel gewechselt und ihr wundgelegener Rücken mit Salbe versorgt wird.
Als sie sich ins letzte Bett gelegt hat, ist ihr Mann benachrichtigt worden. Nun steht er bei ihr, nimmt ihre Hand und spricht sie an: „Rattana, Rattana.“ Sie öffnet die Augen, doch gleich senkt sie wieder ihre Lider und schläft ruhig ein. Schweigend nimmt er Abschied.
Vorsorglich hat er einen schlichten, mit Goldbeschlägen verzierten weißen Sarg anfertigen lassen: Abschiedszeremonie und Einäscherung sollen im Familienkreis stattfinden. Die meisten Verstorbenen werden von ihren Familien nicht einmal im Tod wieder aufgenommen. Verabschiedet werden sie dann von Mönchen und Mitpatienten in einer lichterfüllten Kapelle, die gleich hinter der Pforte des Klosters auf einem Hügel liegt.
Anstelle der Angehörigen überreichen den betenden Brüdern nun die letzten Begleiter des Toten symbolhafte Geschenke – eine letzte Geste voller Würde und Versöhnlichkeit. Im Wechselspiel erwidern sie deren tiefkehlig gestimmten, monotonen Sprechgesang: „Geh und kehre nicht zurück, schlafe und wache nicht wieder auf.“
Niemand weint hier, mitunter wird sogar gewitzelt und gelacht. Hell klingen die Gläser, wenn die Abschiedsgäste Eiswürfel in ihre Softdrinks fallen lassen. Keinen stört es, wenn ein kranker Kuttenträger hustet und ausspuckt und das Singen unterbricht. Andacht ist nicht eine Sache von Anstand, sondern ein innerer Zustand. Ein Wollfaden, der vom Sarg aus durch die Hände aller Mönche reicht, symbolisiert eine letzte Brücke zum Leben. Vor der Einäscherung wird die Leiche mit Milch aus einer jungen Kokosnuß bespritzt.
Beinahe täglich, spät am Nachmittag, quillt schwerer Qualm aus dem Kamin des Krematoriums, der sich wie ein Wahrzeichen des Klosters über das Dach der Kapelle erhebt.
Die Asche der Verbrannten wird in weiße Säckchen gefüllt, mit einem Namensschild versehen und den Verwandten zugesandt – falls diese damit einverstanden sind. Doch inzwischen türmen sich die Aschebeutel: Die Mehrheit der Familien ist nicht einmal bereit, sich mit dem letzten Restchen ihrer verstorbenen Angehörigen abzugeben.
Rattanas weißer Sarg wird ins Heck eines Lieferwagens verfrachtet. Währenddessen schleppt sich bereits, von Mitpatienten gestützt, Tscha Nin, 35, zum letzten Bett. Als der junge Greis hochgehievt wird, setzt sich der Kombi mit Rattanas Überresten in Bewegung. Er wirbelt eine lange, dicke Staubwolke auf.
Über denselben staubigen Weg kam vor zehn Jahren ein junger Wandermönch geschritten, allein, mit nichts als seiner braunen Kutte und seiner Schüssel für das morgendliche Betteln um Reis. Sein Name: Phra Atscharn Alongott. An dem kleinen Kloster zu Füßen des Khaosamjod-Gebirges ging er vorbei in die Berge, wo er in Höhlen lebte und meditierte. Nichts deutete damals darauf hin, daß er zehn Jahre später, als Abt eben jenes Klosters, Zeitungs- und Fernsehinterviews geben, den Premierminister empfangen und sogar im Parlament sprechen würde.
Um 1985 war Aids in Thailand kein Thema. Zwar war begonnen worden, Blutproben aus allen bekannten Risikogruppen auf HIV-Antikörper zu testen. Doch noch 1987 erwiesen sich bei nahezu 200.000 dieser Untersuchungen nicht einmal 100 Proben als positiv.
Wer hätte damals prophezeien mögen, daß heute eine Million Thai HIVinfiziert, mindestens 30 000 an Aids erkrankt, bereits etliche tausend daran gestorben – und daß mittlerweile nirgendwo auf der Welt die Zuwachsraten höher sind? Zu sehen war es für alle Seuchenexperten, denen die Lage in anderen Ländern ebenso bekannt war wie die HIV-freundlichen Rahmenbedingungen in Thailand.
Erhebungen zufolge gehen mehr als 90 Prozent der einheimischen Männer regelmäßig zu Prostituierten. Die wenigsten verwenden Kondome. Unter Freiern wie Huren finden sich etliche, die billiges Heroin spritzen und die teuren Nadeln teilen. Die immergeile Bruderschaft Hunderttausender Sextouristen aus Ländern mit – damals – deutlich höheren HIV-Raten speist das Virus unaufhörlich ein in dieses System heilloser Vermengung von Säften durch „body-“ und „needlesharing“.
In dem 1989 geschriebenen Sex-Reiseführer „Käufliche Liebe in Südostasien“ rät der Autor seinen Geschlechtsgenossen unmißverständlich: „Vermeiden Sie es trotz der erhöhten Infektionsgefahr, Präservative zu benutzen. Sie verringern die Lustgefühle.“
Anfänge von Aufklärung seitens der Regierung und vereinzelte Proteste gegen fremdländische Freier gibt es schon 1989: „Feuert eure Torpedos woanders ab“, rufen Demonstranten 8400 amerikanischen Marinesoldaten entgegen, die Ende Januar im Seebad Pattaya, Sexhochburg im Süden von Bangkok, an Land gehen.
Doch Thailand ist längst noch nicht reif für Warnungen und verschläft die Jahre, in denen das sich abzeichnende Desaster noch hätte abgewendet oder zumindest abgemildert werden können. Die sexhungrigen Gäste haben das Land gleichsam als Ganzes angesteckt, woraufhin sich die Viren in ihm vermehrten wie in einem Organismus. Nun ist Thailand auf dem Weg zur aidskranken Nation. Im letzten Jahr war bereits einer von 25 für die Armee gemusterten Männer HIV-positiv und im Mittel 65, in manchen Städten über 80 Prozent der Prostituierten.
Als Bra Sit zum erstenmal mit einer Hure schlief, war er 13 oder 14. Das war Mitte der achtziger Jahre, etwa zu der Zeit, als sich der Wandermönch Alongott in die Berge zurückzog. Für Bra Sit, der ein Jahrzehnt später Zuflucht im Kloster am Ende des Weges finden wird, war es völlig normal, sich nach dem Schulunterricht mit Kameraden im Puff zu verabreden.
Mit 17 verließ er Schule und Elternhaus. Nachdem er in Bangkok kurz als Bote gearbeitet hatte, lockte ihn ein Freund nach Pattaya. Dort würden sie gut bezahlen für Jungen wie ihn: knabenhaft und kräftig, willig und schön.
„Wenn es Nacht wird in Pattaya“, heißt es bis heute in einem Werbevideo für Sextouren nach Thailand, „leert der Teufel noch ein paar mehr Säcke aus.“ Der Film wendet sich an „alleinreisende Herren“, die sich „hier eine Stunde in einem sauberen Bett entsaften“ wollen.
An guten Tagen zehnmal Sex, manchmal sogar noch öfter – jedesmal steckte Bra Sit 20, im Monat 2000 bis 3000 Mark ein. Das Geld ließ er in Bars, verspielte es oder trug es seinerseits zu Prostituierten. Kondome hat er dabei nie benutzt.
Aids war für ihn nur ein Wort, ein knapper Name für ein neues Leiden, an dem damals ohnehin niemand litt. Gegen Geschlechtskrankheiten gab es außerdem Mittel. Sprache war auch nicht so wichtig bei dem Job. Die Kunden spendierten Drinks und luden zum Tanz, sie flirteten, zärtelten, küßten, grapschten. Dann wollten sie ficken, blasen, give me a blow job, fuck me, fuck you. Oder sie sagten einfach nur „love“ und meinten Sex.
Die meisten seiner Freier kamen aus Deutschland. Manche haben ihm später Fotos geschickt. Sie sind das einzige, was ihm geblieben ist aus jener Zeit. Außer den Viren. Der Teufel hatte seinen Sack ausgeleert.
Zu dieser Zeit lebt Wandermönch Alongott noch immer in Höhlen des Khaosamjod-Gebirges. Durch Meditation möchte er sein „gebrochenes Herz“ kurieren, mit dem die Geschichte seines Mönchslebens ihren Ausgang genommen hat. Sie beginnt beim Karrierestreben eines jungen Ingenieurs in Bangkok, der nach mehrjähriger erfolgreicher Arbeit für die Regierung in Australien studieren darf und seine Freundin warten läßt.
Als Alongott zurückkehrt, hat sie seinen besten Freund geheiratet. Er verliert jeglichen Halt, seine Gefühle laufen Amok gegen die Vernunft. Abend für Abend geht er nun in Bars und trinkt, soviel er kann. Dann fährt er volltrunken mit dem Auto heim. Nach seinem fünften Unfall liegt er lange im Krankenhaus. Narben am ganzen Körper und im Gesicht zeugen bis heute von der Selbstzerstörung.
Seine Pflegemutter, die sich um ihn gekümmert hat, als er mit drei Jahren seine Mutter verlor, bittet Alongott, sein Leben radikal zu ändern. Zunächst widerwillig folgt er ihrem Wunsch, besorgt sich eine braune Kutte und wird Wandermönch.
Drei Jahre Wanderschaft, sechs Jahre allein in den Bergen. Leute aus benachbarten Dörfern kommen vorbei, um Meditationen zu lernen, mit deren Hilfe sie Krankheiten heilen wollen. Der oberste Mönch der Provinz bittet ihn schließlich, Abt des kleinen Klosters am Fuße der Berge zu werden. Drei Brüder leben da. Alongott nimmt an.
Bra Sit ist inzwischen krank geworden, hat Durchfall, verliert an Gewicht. Auf die Idee, daß er an Aids leiden könnte, kommt er nicht. Da er sich aber mittlerweile zu schwach fühlt für den Stricher-Job, geht er nach Bangkok zurück und arbeitet wieder als Laufbursche für 200 Mark im Monat.
Wieviel Freiern er dadurch sein eigenes Schicksal erspart hat, gibt die Aids-Arithmetik nicht her. In ihrer Anfang 1995 veröffentlichten Studie „Aids, Sex und Tourismus“ haben Wissenschaftler der Freien Universität Berlin unter anderen auch „schwule Männer als Sextouristen“ in Pattaya nach ihrem Verhalten während des Urlaubs befragt.
Im Durchschnitt hat jeder Befragte während seines Aufenthaltes mit 12 bis 13 einheimischen Männern insgesamt mehr als 40mal Sex gehabt. Noch 1991/92 haben 16 Prozent beim aktiven und 14,3 Prozent beim passiven Analverkehr nie und ähnlich viele nur unregelmäßig Kondome benutzt.
Nur etwa die Hälfte der weitaus zahlreicheren heterosexuellen Bumstouristen haben immer, aber mehr als 30 Prozent nie Kondome benutzt. Die Forscher kommen zu dem Schluß, daß mindestens 10 Prozent „aller in der Bundesrepublik vermuteten jährlichen Neuinfektionen mit HIV“ auf Sextourismus zurückzuführen sind.
Zurück in Bangkok, lernt Bra Sit die um ein Jahr ältere Wäscherin Tam Lond kennen. Er ist der erste Mann in ihrem Leben. Bald ist sie schwanger, die beiden heiraten. Von allen Menschen, mit denen er je Sex hatte, sagt er, ist sie die erste, für die er auch Liebe empfindet.
Dem jungen Abt Alongott trägt sein Ruf als guter Lehrer bald Einladungen zu Vorträgen ein. Regelmäßig reist er nach Bangkok, um Ärzten und Krankenschwestern den Wert von Meditationen für die Medizin näherzubringen. Während eines Vortrages Anfang 1991 meldet sich ein Student mit einer für den Abt völlig überraschenden Frage zu Wort: „Wie können Aids-Kranke in dieser Gesellschaft friedlich leben?“
Bis zu dem Tag hat Alongott von Aids noch nie etwas gehört. Obwohl sich die Regierung um Aufklärung bemüht, ist die Gefahr kaum bis ins öffentliche Bewußtsein gedrungen. Die Leute sind es gewohnt, Probleme erst anzugehen, wenn sie da sind. Was sie nicht wahrnehmen, wollen sie nicht wahrhaben. Während sich vermutlich schon 300.000 Thai mit HIV infiziert haben, sind nicht einmal 150 Aids-Fälle gemeldet worden.
Um mehr über die neue Krankheit zu erfahren, besucht Alongott Aids-Kranke in einem Bangkoker Krankenhaus – und bekommt erste Vorahnungen vom Unheil, auf das sich sein Land zubewegt. Vor allem über die Zustände in der Klinik ist er schockiert: Die Aids-Patienten liegen separiert, niemand kommt zu ihnen, kein Arzt, keine Krankenschwester kümmert sich um sie.
„Da erkannte ich“, erinnert er sich, „daß Aids nicht nur ein medizinisches, sondern vor allem ein soziales Problem ist.“
Er besucht die Klinik nun regelmäßig, redet mit Ausgestoßenen, füttert Kranke, wäscht Siechende. „Ich war der einzige, der diese Menschen überhaupt angefaßt hat.“ Als der erste in seinen Armen stirbt, begreift er, daß die Einsamkeit der Sterbenden schwerer wiegt als all ihr körperliches Leid. Und beschließt, aus seinem Kloster ein Aids-Hospiz zu machen.
Vor gut drei Jahren bringt Alongott den ersten Patienten ins Wat Prabat Nampu, wo mittlerweile acht Mönche leben. Nach weniger als drei Monaten haben sich jedoch alle Brüder aus Furcht vor Ansteckung aus dem Staub gemacht.
Es folgt eine bittere Zeit zu zweit. Mehrfach versuchen Leute aus der Umgebung, ihn samt seinem Pflegefall zu vertreiben. Da sie zudem keine Spenden geben, muß er morgens weite Wege zurücklegen, um genug Nahrung für sich und seinen Patienten zusammenzubetteln. Anfang 1993 ist der Streit mit den Nachbarn beigelegt. Alongott hat den Dorfoberen versprochen, daß kein Kranker ihre Siedlungen betreten werde. Von dort kommen inzwischen sogar Freiwillige, ihm zu helfen. Eine Krankenschwester arbeitet fest bei ihm.
In Thailand sind mittlerweile über 2000 Aids-Fälle registriert. 6 HIV-Positive leben jetzt im Kloster. Im Verlaufe des Jahres kommen etwa 100 weitere, nicht mehr alle können bleiben. Die Kapazitätsgrenzen sind längst erreicht. Neue Hütten müssen gebaut werden. Im Jahr 1994 kommen rund 5000 Kranke, viele im falschen Glauben, hier würde ihr Leiden geheilt. Lediglich 700 werden zugelassen, viele nur einen Monat lang aufgepäppelt und wieder weggeschickt. Bis zum Ende des Jahres sterben im Wat 136 Menschen, unter ihnen 10 Mönche.
Anfang September 1994 laufen die Lebenswege von Alongott und Bra Sit und dessen Frau zusammen. Im sechsten Monat von Tam Londs Schwangerschaft ist ihr Blut routinemäßig auf HIV-Antikörper getestet worden: positiv. Erst daraufhin läßt auch Bra Sit sich untersuchen.
Er fährt zu seinen Eltern, wohlsituierten Leuten, und schildert ihnen aufrichtig seine Lage. Der Vater zeigt Verständnis, doch gegen dessen Willen wirft die Mutter ihren Sohn aus dem Haus. Mit Aids will sie nichts zu tun haben. In einer der neuartigen No-name-Kliniken, die Aids-Patienten Anonymität zusichern, empfiehlt man ihm das Wat Prabat Nampu.
Zwei Monate nach Ankunft der Eheleute wird dort ihr Baby geboren. Seinen Namen erhält es von Abt Alongott. Er nennt es Porn Bun Pot, „Segen aus den Bergen“.
Sogar der damalige Premierminister Tschuan Leekpai hat die Kleine schon gesehen. Er ist durch Zeitungsberichte auf das Hospiz aufmerksam geworden. Mit ihm und vor allem in seinem Gefolge kommen Fernsehteams aller thailändischen Anstalten. Heute kennen Millionen das Aids-Kloster von Lop Buri.
Da der Nation nun in nie gesehener Deutlichkeit vorgeführt wird, wohin Aids schließlich führt, aber auch, daß Mitmenschlichkeit gefragt ist statt Ausgrenzung, bildet das Kloster einen Anfangspunkt für die vielleicht wirkungsvollste Aids-Aufklärung in Ländern wie Thailand: Information durch Realismus.
Wie kraß der Unterschied zwischen Vorstellung und Anschauung sein kann, zeigen die täglich größer werdenden Besuchergruppen. Obwohl alle wissen, was sie erwartet, reagieren die meisten fassungslos auf die Wirklichkeit: Plötzlich schauen sie dem Tod bei der Arbeit zu.
Das Entsetzen auf ihren Gesichtern, wenn sie sich, manche mit Taschentuch vor dem Mund, durch die Krankenstation bewegen, dieses Hinschauen und zugleich Wegschauen, erinnert an die Bilder der Deutschen, die man 1945 zwangsweise durch befreite Konzentrationslager schickte.
Am Eingang werden Holzblumen verkauft, von Patienten kunstvoll aus Zuckerrohr und Palmfurnier gefertigt. Eine junge Besucherin kauft einen Strauß und bringt ihn zu Tscha Nin, dem 35jährigen, der Rattana im letzten Bett der Station abgelöst hat. Der umklammert eine Blume – etwa so, wie er sich immer wieder am Geländer des Bettes festkrallt, als wolle er sich aufrichten.
Dann schlägt er das Gebinde unter regelmäßigem stoßartigem Stöhnen ein ums andere Mal auf das Gestänge, ohne Unterlaß, stundenlang, bis alle Blätter und Blüten auf Bett und Boden verteilt sind und er nur noch das Stöckchen umfaßt, das er aber nicht losläßt, sondern weiterschlägt, Stunde um Stunde weiterschlägt bis in die Nacht. Das Leben läßt ihn nicht los, als hätte es mit ihm noch irgend etwas zu erledigen.
Jeden Tag macht der Abt seine Runde durch die Station, spricht mit Patienten, streichelt Köpfe, nimmt Hände in seine. Als er bei Tscha Nin ankommt, hilft er ihm auf, stellt ihm Fragen, doch der Sterbende starrt ihn nur an und antwortet mit Stöhnen und Schlagen seines Stöckchens – verschlüsselte Botschaften, die zu verstehen bis zu seinem Tod am nächsten Morgen niemandem gelingt.
Ein Fernsehteam begleitet den Abt. Die Kamera sieht den Hinfälligen beim Sterben zu. Alongott hat nichts dagegen. Noch im Tod leisten die Patienten etwas Paradoxes: Sie sterben für das Leben. Aufrüttelnde Aids-Aufklärung hält Alongott für das beste, damit Thailand endlich erwacht.
Am nächsten Tag wird er im Parlament sprechen. Er wird berichten, daß schon 100.000 Menschen das Aids-Kloster von Lop Buri besucht haben; daß die Mönche der Flut von Neuanmeldungen kaum noch Herr werden; daß schon längst nur noch Fälle mit Vollbild Aids einen Platz erhalten; daß er weitere Hütten hat errichten lassen und bis zu 200 Patienten aufnehmen könnte, hätte er mehr Geld.
Es ist der Tag, an dem Bra Sits Eltern ins Wat Prabat Nampu kommen und, als sie wieder fahren, das Baby mitnehmen, probehalber. Der Vater hat es so gewollt. Sein Sohn freut sich und lächelt den ganzen Tag, und am Abend spielt er mit ein paar anderen Patienten Boccia.
Alongott hat den Parlamentariern erklärt, daß es auf Dauer in jeder Provinz ein Sterbekloster geben müsse. Doch schon zehn Versuche, das Aids-Kloster von Lop Buri zu kopieren, sind gescheitert, weil die Nachbarn Mönche und Patienten vertrieben haben.
„Wir konnten es hier nur schaffen“, vermutet Alongott, „weil unser Wat am Ende des Weges liegt“ und weil keiner es ohne seine Erlaubnis verlassen darf.
Drei Tage später steht vor dem Haus des Abtes früh morgens Bra Sit mit verweinten Augen und bittet darum, verreisen zu dürfen. In der Hand hält er ein Bündel Geldscheine.
Schluchzend erzählt der kleine Mann, er müsse sofort in den Süden fahren, zu seinen Eltern. Seine Mutter, die sein Kind ja aufziehen müßte, dulde es keinen Tag länger in ihrem Haus. Und notfalls werde sie es aussetzen.
Auf einem Motorrad läßt sich Bra Sit nach Lop Buri zur Bahn bringen. Seine Reise beginnt auf jenem aufstaubenden Fahrweg zwischen abgeernteten Maisfeldern hindurch, den er eigentlich nicht mehr benutzen wollte in diesem Leben.
Von Jürgen Neffe (Der Spiegel)